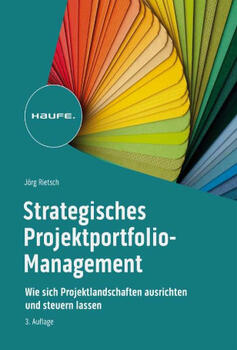Ergebnisse einer qualitativen Studie Erfolgsfaktoren des Multiprojektmanagements
Ergebnisse einer qualitativen Studie Erfolgsfaktoren des Multiprojektmanagements
In der Vergangenheit wurde vor allem das Einzelprojektmanagement hinsichtlich seiner Qualitätskriterien und Erfolgsfaktoren untersucht. Entsprechende ganzheitliche Ansätze für das Multiprojektmanagement (MPM) existieren hingegen nicht. Das soll jetzt ein groß angelegtes Forschungsprojekt des Lehrstuhls für Innovations- und Technologiemanagement von Prof. Dr. Hans Georg Gemünden an der Technischen Universität Berlin ändern. Dieser Artikel fasst die Erkenntnisse einer ersten Studie im Rahmen des Forschungsprojekts zusammen. Er zeigt die Kernprobleme des MPMs auf, skizziert den aktuellen Stand in der Projektselektion und -priorisierung und stellt dar, welche organisatorischen Faktoren die Qualität des MPMs beeinflussen.
Übergeordnetes Ziel des Forschungsvorhabens ist es, erfolgskritische Einflussgrößen auf das MPM wissenschaftlich fundiert zu erarbeiten, zu überprüfen und daraus Handlungsempfehlungen für Unternehmen abzuleiten.
Das Forschungsprojekt
Das Forschungsprojekt untergliedert sich in zwei Abschnitte, wobei dieser Artikel Ergebnisse der ersten "Interview-Studie" vorstellt, die Ende letzten Jahres beendet wurde. Im Zeitraum von April bis August 2004 wurden Daten des MPMs von 16 deutschen Unternehmen (mehr als 1.500 Mitarbeitern) branchenübergreifend erhoben.
Die Unternehmen wurden auf Basis telefonischer Vorgespräche ausgewählt, bei denen die Erfahrung der Unternehmen im Projektmanagement, die Größe des Unternehmens und allgemeine Charakteristika des Portfolios erfragt wurden. Schließlich fiel die Wahl auf Unternehmen, deren Portfolio vorrangig aus internen Projekten besteht. Bei internen Projekten, wie z.B. Organisationsprojekten, IT-Projekten oder Investitionsprojekten ist meist das (höhere) Management der Auftraggeber. Eine weitere Bedingung war, dass die Unternehmen in der Vergangenheit bereits Erfahrung im Umgang mit dem Management einer Vielzahl von Projekten gesammelt und einen eigenen Weg gefunden hatten, mit den entstandenen Herausforderungen umzugehen. Wir befragten insgesamt 31 Schlüsselpersonen durch qualitative, semi-strukturierte Interviews. In der Regel wurden pro Unternehmen zwei Personen befragt, die das MPM möglichst aus verschiedenen Blickwinkeln wahrnehmen:
- Eine Person gehörte dem Top-Management an (Bereichsleiter, Vorstand, Geschäftsführung, etc.).
- Die andere Person war für die Koordination der Projektlandschaft verantwortlich und trug häufig den Titel Portfoliomanager oder Multiprojektmanager.
Die Datenerhebung und -auswertung wurde entsprechend den gängigen Vorgehensmodellen für qualitative wissenschaftliche Studien durchgeführt.
Die vier Hauptprobleme im Multiprojektmanagement
Fasst man die Interview-Aussagen der befragten Personen zusammen und verdichtet diese, so sind es im Wesentlichen vier Gründe, die ein Unternehmen veranlassen, sich mit MPM zu beschäftigen (die Reihenfolge entspricht der Häufigkeit der Nennung):
- Fehlende Informationen über die Projektlandschaft: Die Daten- und Informationsqualität über die Projektlandschaft bzw. das Projektportfolio ist häufig unzureichend, was zu weit reichenden Fehlentscheidungen führen kann. Die befragten Führungskräfte machten deutlich, dass Ursachen meist in inadäquat ausgestalteten Prozessen sowie in der fehlenden Abdeckung durch geeignete IT-Lösungen liegen.
- Verschwendung von knappen Ressourcen: Das Ressourcenmanagement ist in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus von Entscheidern und Projektportfolio-Verantwortlichen gerückt. Als zentrale Herausforderungen nannten die Befragten die Priorisierung, Freigabe und konkrete (Re-)Allokation von Ressourcen. Wegen zeitaufwändiger und zu häufiger Iterationen bei der Abstimmung seien die Prozesse oft zu ineffizient.
- Fehlende Ausschöpfung von Synergiepotentialen: Häufig ist das Projektportfolio als Ganzes weniger als die Summe seiner Projekte. Warum? Gründe dafür sind interne Schnittstellenprobleme sowie die oft kurzfristige Sichtweise bei der Projektauswahl, die es nicht ermöglicht, Synergiepotentiale durch Verbundwirkungen von Projekten zu erkennen. Insbesondere Profit-Center orientierten Organisationen fällt es schwer, Synergien auszuschöpfen, da Synergiepotentiale aus einer ganzheitlichen Betrachtung heraus wahrgenommen werden müssen und zwar bereits während der Projektinitiation und der anschließenden Projektkonsolidierung.
- Fehlende Strategie-Transparenz: In vielen Interviews wurde bemängelt, dass Unternehmensstrategie und Entscheidungen nicht transparent seien. Unzureichende Richtungsvorgaben können zwar zu effizienten, nicht jedoch zu zielkonform ausgerichteten Portfolios führen. Häufige und drastische Kurswechsel schüren Unmut und führen langfristig zu einer mangelnden Akzeptanz von Entscheidungen. Werden speziell dafür Anlaufpunkte eingeführt (z.B. Project Management Offices), kann das helfen, die "gelebte Schnittstelle" zwischen dem Top-Management und der aktuellen Projektlandschaft zu sichern.
Konsequenzen aus den genannten Problemen lassen sich am Beispiel des Trichtermodells verdeutlichen. Die Idee zum Trichtermodell entstammt den Arbeiten von Wheelwright und Clark (Stephen C. Wheelwright, Kim B. Clark, "Revolutionizing Product Development",1992), die diese Darstellungsform Anfang der 90er Jahre einführten, um Probleme der Produktentwicklungs-Abläufe zu verdeutlichen. Produkte bzw. Projekte durchlaufen den Trichter von links nach rechts. Links stehen die Projektideen, rechts kommen die abgeschlossenen Projekte heraus. Der Weg durch den Trichter verläuft jedoch keineswegs gradlinig, sondern eher verworren, wie Bild 1 verdeutlicht.
…