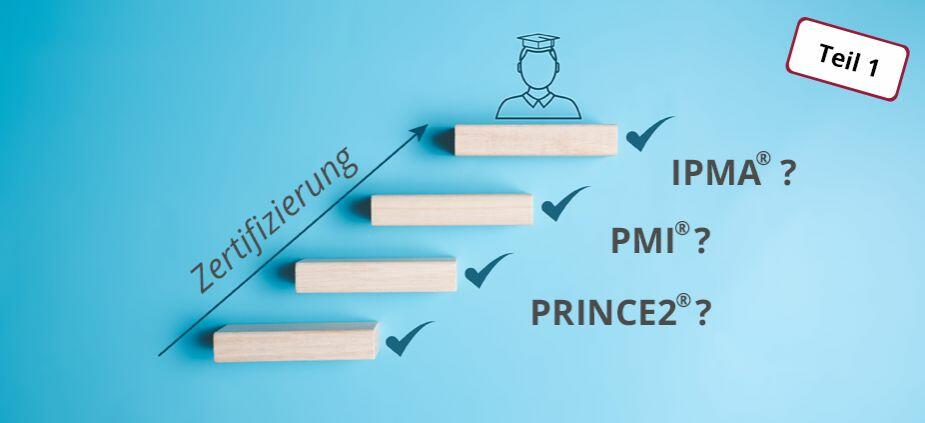
IPMA, PMI und PRINCE2 Projektmanagement-Zertifizierungen im Vergleich
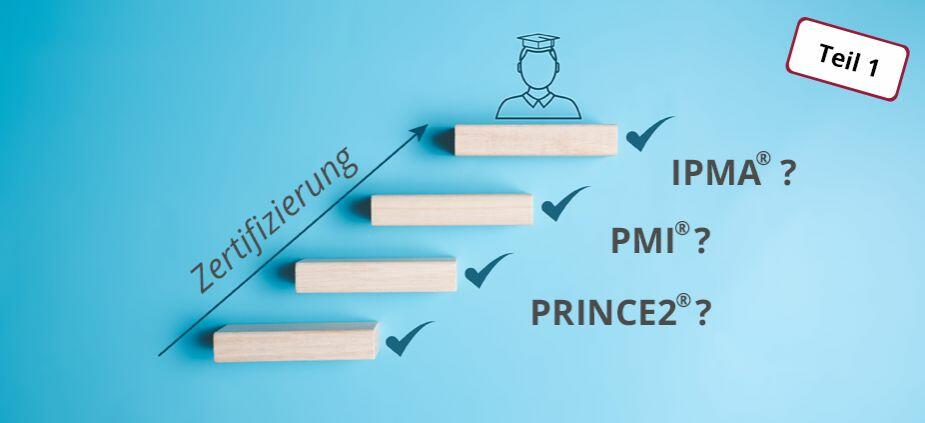
Sie möchten sich im Projektmanagement zertifizieren, wissen aber nicht, für welchen der drei großen Anbieter Sie sich entscheiden sollen? Teil 1 dieser Artikelserie bringt Licht in die Zertifizierungsangebote von IPMA®, PMI® und AXELOS Ltd. (PRINCE2®).
Management Summary
Als Mitglied erhalten Sie die wichtigsten Thesen des Beitrags zusammengefasst im Management Summary!
IPMA, PMI und PRINCE2 Projektmanagement-Zertifizierungen im Vergleich
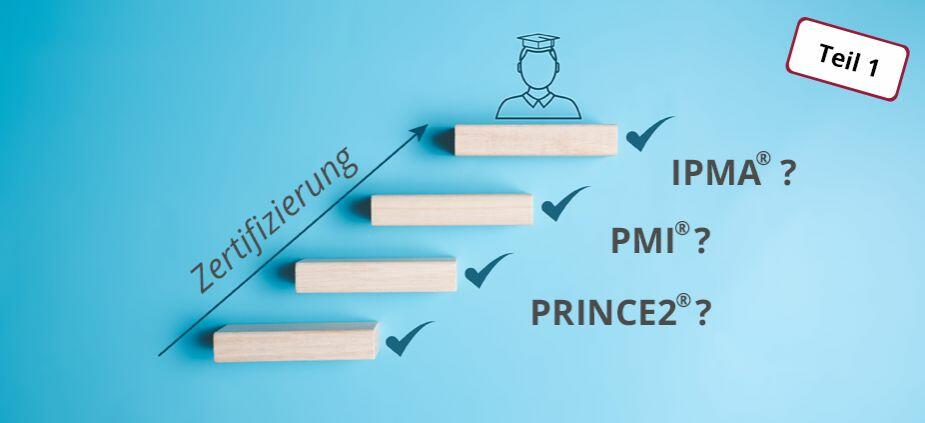
Sie möchten sich im Projektmanagement zertifizieren, wissen aber nicht, für welchen der drei großen Anbieter Sie sich entscheiden sollen? Teil 1 dieser Artikelserie bringt Licht in die Zertifizierungsangebote von IPMA®, PMI® und AXELOS Ltd. (PRINCE2®).
Management Summary
Als Mitglied erhalten Sie die wichtigsten Thesen des Beitrags zusammengefasst im Management Summary!
Nachgewiesene Projektmanagement-Kompetenz wird heute in vielen Berufen verlangt oder ist zumindest ein Plus im Lebenslauf. Dies gilt umso mehr, wenn das Know-how von einem der großen Zertifizierer für Projektmanagement kommt, denn diese stehen für ein klar definiertes Verständnis von Projektmanagement sowie einheitliche und dokumentierte Inhalte. Wer ein entsprechendes Zertifikat besitzt, hat einen anerkannten Beleg für die Kenntnis bestimmter Philosophien, Methoden, Begrifflichkeiten und Lösungsansätze. Die höheren Zertifizierungsebenen erfordern zum Teil zusätzliche Nachweise für eigene Projekterfahrung.
Dabei haben sich über Jahrzehnte hinweg drei Organisationen und Standards am Markt durchgesetzt, und dies weltweit: IPMA®, PMI® und AXELOS (PRINCE2®). Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die Angebote dieser drei Institutionen und zeigt, wie die Verbände agile Vorgehensweisen und Zertifizierungen in ihre Angebote integrieren.
Die Zertifizierungskonzepte der drei großen Anbieter
Mit dem rasanten und weltweiten Bedeutungsgewinn der Disziplin Projektmanagement sind auch die drei Organisationen IPMA, PMI und AXELOS gewachsen und haben sich im Bereich Projektmanagement als führende Größen etabliert. Über sie haben sich Projektmanagerinnen und Projektmanager organisiert und ihre Verfahren, Methoden sowie Tools dokumentiert und weiterentwickelt. Dazu gehörte das Festlegen einer einheitlichen, dokumentierten Fachsprache, um Konflikte durch unterschiedliche Begriffsverständnisse zu vermeiden. Auf Basis dieses Wissens haben sie schließlich Standards entwickelt. Entsprechende Zertifikate belegen das Vorhandensein der erforderlichen Kompetenzen. Aus rechtlichen Gründen wurden für Prüfungen und Ausstellung der Zertifikate in manchen Ländern formell eigenständige Zertifizierungsstellen etabliert.
Zertifizierungspfade mit mehreren Leveln
Grundsätzlich bieten alle drei großen Anbieter aufeinander aufbauende Zertifizierungslevel an. Die jeweils erste Stufe wendet sich an Einsteigerinnen und Einsteiger, wobei die Zertifizierungen von IPMA und AXELOS offen für alle sind, während PMI (Fach-)Abitur oder eine vergleichbare Ausbildung voraussetzt. Bei der IPMA-Einsteigerqualifizierung gibt es in Deutschland eine Erweiterung: Die GPM hat unterhalb des IPMA-Einsteigerlevels unter dem Begriff "Basislevel" ein weiteres Zertifikat auf den Markt gebracht und den Zertifizierungspfad damit von vier auf fünf Level erweitert. In Österreich gibt es ein ähnliches Basisangebot, das jedoch nicht als Teil des Zertifizierungspfades definiert ist.
Die International Project Management Association (IPMA®)
3 Mitgliedsgesellschafen im deutschsprachigen Raum
Die 1965 gegründete IPMA International Project Management Association, deren zentrales Sekretariat sich in den Niederlanden befindet, vereint als Dachverband derzeit etwa 70 Mitgliedsgesellschaften weltweit. Ursprünglich startete die IPMA als internationales Netzwerk für Projektmanagerinnen und Projektmanager 1996 begann sie mit ersten Zertifizierungsaktivitäten.
Im deutschsprachigen Raum gibt es drei Mitgliedsgesellschaften:
- Die GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V. (www.gpm-ipma.de)
- Die pma – Projekt Management Austria (www.pma.at/de/)
- Die spm – Swiss Project Management Association (www.spm.ch)
Der Mensch im Mittelpunkt
Die IPMA stellt ausdrücklich nicht die Methodik ins Zentrum ihrer Aktivitäten und Veröffentlichungen. Sie hat vielmehr den Menschen im Blick, bzw. seine für erfolgreiche Projektarbeit benötigten Kompetenzen, einschließlich Social Skills. Mit ihren Zertifizierungen will die IPMA nicht nur bestimmtes Wissen bescheinigen, sondern persönliche Kompetenz und damit die Eignung einer Person, bestimmte Projektmanagementaufgaben erfolgreich durchzuführen.
Die Individual Competence Baseline (ICB) als Standard
Das übergreifende Projektmanagement-Verständnis der in der IPMA organisierten Institutionen wird seit 1999 in der sogenannten IPMA Competence Baseline (ICB®) zusammengefasst und veröffentlicht. Es gibt sie in unterschiedlichen Aufbereitungen für Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement. Aktuell gilt die Version ICB®4, sie kann bei allen drei deutschsprachigen IPMA-Mitgliedsorganisationen kostenlos heruntergeladen werden. Hier die Links für Deutschland, Österreich und die Schweiz.
Die aktuelle Version ICB®4 wurde 2015 verabschiedet und nach und nach von den Länderorganisationen übernommen. Sie unterscheidet sich deutlich von ihren Vorgängerversionen. Mit breiter internationaler Mitgliederbeteiligung hatte man sich vor allem der Aufgabe gestellt, aktuelle Konzepte wie z.B. Agilität konsequent in das IPMA-Modell zu integrieren.
So formuliert die ICB4, was jemand können muss, um in einer Projektumgebung erfolgreich zu agieren, während das Wie – vor allem Regeln, Prozesse und Methodik – bewusst offenbleiben. Agile Teams, User Stories, Kanban-Boards, Daily Standup-Meetings – all diese Ansätze sind damit ebenso akzeptiert wie Netzpläne, Balkenpläne, Meilensteintrendanalysen oder Projektstatus-Meetings. Die Botschaft, dass die oder der Einzelne die Freiheit hat, die Umsetzung der Konzepte selbst zu gestalten, hat sich auch im Namen niedergeschlagen: Das I in ICB steht nun nicht mehr wie früher für IPMA, sondern für "Individual".
Sofort weiterlesen und testen
Erster Monat kostenlos,
dann 24,99 € pro Monat
-
Know-how von über 1.000 Profis
-
Methoden für alle Aufgaben
-
Websessions mit Top-Expert:innen







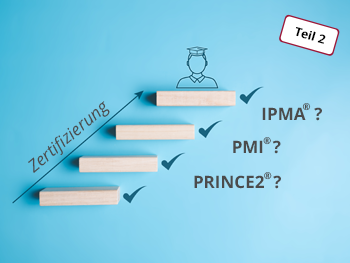




Guter Überblick der wichtige Aspekte außer Acht lässt
12.06.2019
Sehr geehrte Frau Wagner,
ganz herzlichen Dank für den an sich ausgezeichneten Überblick über drei wichtige (große) Zertifizierer im Projektmanagement. Ihr Artikel ist grundsätzlich fundiert und hilfreich, wenn man einen ersten Überblick über die drei wichtigsten Zertifizierer sucht.
In Ihrem Vergleich und ihren kritischen Anmerkungen fehlen mir persönlich drei Dinge, die sowohl in unserem Haus als auch bei unseren Kunden eine große Rolle spielen: der (hohe) zeitliche und finanzielle Aufwand zur Zertifizierung, die Frage der Re-Zertifizierung sowie die Frage der Praxisrelevanz.
Leider haben sie einen wichtigen Zertifizierer außer Acht gelassen, die mittlerweile fast 4000 ProjektleiterInnen in 125 Ländern zertifiziert hat: die IAPM (https://www.iapm.net). Die Zertifizierung der IAPM hat einige wichtige Vorteile, die alle von Ihnen genannten Anbieter nicht bieten können: sie ist fachlich fundiert und dennoch preisgünstig, kann von zuhause absolviert werden und verzichtet auf die teure Re-Zertifizierung. Letztere ist aus meiner Sicht reine Geldschneiderei. Wie an der Hochschule, die ja auch nicht rezertifiziert, genügt die rein fachliche Ausbildung auch im Projektmanagement nicht, sondern kann erst durch die tägliche Praxis und deren regelmäßige Reflexion (z.B. in einer Gruppe von Kollegen oder mit einem Coach oder Mentor) zur echten Kompetenz werden.
Wer nicht nur Fachwissen sondern auch echtes Können unter anderem im Bereich der sozialen und emotionalen Kompetenz erwerben will, sollte sich um eine Zertifizierung bemühen die diese Kompetenz einschließt, wie dies zum Beispiel bei Consensa der Fall ist (https://www.consensa.com/de/qualifizierung-training/zertifizierungen/ ).
Über eine Ergänzung Ihres Artikels zu den genannten Fragen würde ich mich freuen.
Mit herzliche kollegialen Grüßen,
Daniela Mayrshofer
Re-Zertifizierung ist nicht nur Geldschneiderei
12.06.2019
Guten Tag Frau Mayrshofer
Ich finde den grundsätzlichen Gedanken hinter der Re-Zertifizierung, nämlich die Bestätigung weiterhin am Ball zu bleiben und seine Kompetenzen laufend weiter zu entwickeln, ein wichtiges Merkmal der IPMA Re-Zertifizierungen. Ich kann Ihnen hier als einer der CH Lead Assessoren auch bestätigen, dass es bei diesen genau um diesen Punkt geht: hat sich der zertifizierte Kandidat weiterhin mit Projekten befasst (Erfahrung aufgebaut in eigenen Projekten), hat sich der Kandidat entsprechend auf dem Gebiet des Projektmanagements auch weitergebildet (und ist nicht auf dem Stand der Zertifizierung stehen geblieben), und wie sind diese Erfahrungen weiter entwickelt worden? Dass es andere Anbieter gibt, welche daraus lediglich Profit schlagen wollen, kann und will ich nicht dementieren, jedoch ist dies genau einer der echten Vorteile des IPMA Zertifikates, welches hier detailliert die Informationen von den Kandidaten abholt. Gerne schaue ich mir auch die von Ihnen erwähnten Anbieter genau an, ich bin immer offen für neue Informationen und Anbieter.
Freundliche Grüsse
Martin Rohner
Sinn und Unsinn von Rezertifizierungen
14.06.2019
Lieber Herr Lohner,
vielen Dank dafür, dass sie die Diskussion über diese wichtige Frage der Re-Zertifizierung mit mir führen. Ich finde es ein wichtiges Thema, das meiner Meinung nach in der Fachöffentlichkeit zu wenig Beachtung findet.
Die Überprüfung der beruflichen Grundausbildung in externe Hände zu legen, ist natürlich eine der großen Errungenschaften unseres hiesigen Ausbildungssystems. Da Projektmanagement eine fachübergreifende Kompetenz ist, sind hier Institutionen außerhalb unseres staatlichen Ausbildungssystems durchaus sinnvoll.
Ebenso unbestritten ist es, dass sich alle Menschen, die wirksam in Projekten arbeiten wollen, weiterentwickeln und fachlich am Ball bleiben müssen. Gerade in Zeiten der Digitalisierung und den damit verbundenen fundamentalen Veränderungen wird dies eine Frage des wirtschaftlichen Überlebens vieler Unternehmen sein.
Infrage steht für mich, ob die Verantwortung, dies zu überprüfen, in "fremde" Hände gelegt werden soll.
Für mich hat dieses Thema eine Menge mit Selbstverantwortung und Führung zu tun. Beides ist für mich nicht delegierbar.
Die meisten Menschen in Projekten, die ich kenne, sorgen hier selbstverständlich für die die eigene Qualifizierung. Und das Gespräch darüber, ob hier die Richtung stimmt, obliegt entweder der eigenen Führungskraft oder – in agileren Kontexten – internen Coaches, Mentoren und Kollegen, die die Situation Vorort deutlich besser einschätzen können. Auf diesem Wege kann sehr genau feststellt werden, ob und wie sich jemand fachlich fortbildet (das muss nicht immer in „offiziellen“ Fortbildungen sein) und welche Erfahrungen entstehen, aus denen „Lessons Learned“ gezogen werden können. Diesen Prozess als Teil einer interne Wissens- und Fehlerkultur (Lernende Organisation) zu etablieren ist mittlerweile mehr als die Kür für Organisation, die zukunftsfähig bleiben möchten.
Nun werden Sie berechtigt fragen, wie dies mit neuen Bewerbern sei. Ich persönlich erkenne deren Lern- und Entwicklungsfähigkeit meistens schon im Lebenslauf, spätestens im allerersten Telefonat, in dem ich genau dazu ein zwei Fragen stelle. Sollte ein Kandidat tatsächlich infrage kommen, kann der Rest unschwer in den folgenden Einstellungsgesprächen geklärt werden. Die formale Re-Zertifizierung hat folglich aus meiner Sicht wenig bis gar keine Praxisrelevanz.
Ich bin aber sehr gespannt, welche Aussagen dazu Frau Wagner im zweiten Teil des Artikels machen wird.
Mit herzlichen Grüßen,
Daniela Mayrshofer
Kompetenzbasierte Zertifizierungen sind echt gut!
18.06.2019
Hallo Frau Mayrshofer,
ich gebe Ihnen Recht, was die Geldschneiderei bei einer Re-Zertifizierung angeht. Allerdings trifft dies bei IPMA m.E. nicht zu, denn diese basiert weniger auf der fachlichen Ausbildung als mehr auf der real praktizierten Kompetenz.
Zudem hilft jedem eine Reflexion der eigenen Kompetenzen. Deshalb gebe ich dies gerne an Dritte ab - sie sagen delegieren. Ein Begriff der m.E. gar nicht passt. Ich sehe es wie ein Feedback auf mein eigenes Bild. Wer das nicht regelmäßig tut, hat m.E. keine Chance sich zu verbessern.
Viele Grüße
Tassilo Kubitz
Sorry, Frau Wagner,ich habe…
12.06.2019
Sorry, Frau Wagner,ich habe überlesen, dass sie einen Teil meiner Fragen in Teil 2 beantworten. Bin sehr gespannt auf den zweiten Teil , ;-) Daniela Mayrshofer
Hallo Frau Wagner, Ihren…
12.06.2019
Hallo Frau Wagner,
Ihren Artikel und die bis dato sichtbaren Kommentare von Frau Mayrshofer und Herrn Rohner habe ich mit Interesse gelesen. Auf den Teil 2 bin ich genauso gespannt wie Frau Mayrshofer.
Bis jetzt zeigt der Artikel Infomationen, die für ähnliche Thematik bereits mehrfach in Fachartikeln und studentischen Arbeiten behandelt worden sind.
Ich habe darin immer wieder vermisst, dass
- der Leser eine Hilfe bei seiner Auswahl seiner PM-Zertifizierungen bekommt
- der Leser Daten zu Aufwand und Kosten erhält *
- der Leser auf "Alleinstellungsmerkmale" der Zertifikate hingewiesen wird.
... aber das finde ich sicherlich in Ihrem Teil 2.
* für den Punkt Aufwand und Kosten ist Ihnen u.U. der download von meiner Xing-Seite hilfreich (Vergleich ausgewählter PM-Zertifikate ==> https://www.xing.com/profile/Udo_Schmidt/portfolio?sc_o=mxb_p)
Bis dann
Udo Schmidt
Einige Anmerkungen
18.06.2019
Hallo Frau Wagner,
vielen Dank, dass Sie dieses Thema erneut in meine Erinnerung bringen. 2014 habe ich mich schon einmal damit beschäftigt und eine Arbeit von Dr. Paul Giammalva gelesen (A comparison of 43 project management certifivates).
Die 43 setzen sich allerdings auch den Varianten der von Ihnen genannten großen drei und einiger weiterer zusammen.
Eine wichtige Erkenntnis für mich war der Verbreitungsraum der Zertifikate, der sicherlich an der Herkunft des Mutterkonzerns hängt. Hier liegt IPMA mit Europa vorne, während PMI in USA und Asien verbreiteter ist. PRINCE2 erschien im Umfeld UK beliebt.
Die Aufwände ein Zertifikat zu erhalten wurden von o.g. Autor in der Reihenfolge PRINCE2, PMI, IPMA angegeben, wobei hier immer deutliche Abstände herrschen. An der Spitze lag GPM (Green Project Management) - seit 2010.
Ich freue mich sehr auf den zweiten Teil, um Ihre Sicht auf meine Anmerkungen zu reflektieren.
Viele Grüße
Tassilo Kubitz
Übersichtliche Aufarbeitung
06.02.2023
Vielen Dank Frau Wagner,
mit dieser Erklärung kann man sich besser für eine potenzielle Zertifizierung oder Ratschlag derer entscheiden. Die Leitmotive mit den zusätzlichen ethischen Grundsätzen waren für mich neue Erkenntnisse.
Ein Zusammenfassendes Schaubild (Matrix) zum direkten Vergleich könnte neben dem guten Management Summary ebenfalls hilfreich sein.
MfG
Michèl
Antwort der Autorin auf die bisherigen Kommentare
18.10.2023
Liebe Frau Mayrshofer, liebe Mitdiskutierende,
für Ihre engagierten und fundierten Beiträge bedanke ich mich sehr herzlich. Und ja, wesentliche Punkte der Diskussion werden in Teil 2 noch angesprochen, u.a. die Diskussion um den Sinn der Zertifizierung und - soweit vorab - auch ein kurzer Hinweis auf die IAPM als Beispiel für eine lebenslange Zertifizierung.
Recherche und Umsetzung dieses zweiteiligen Beitrags waren sehr aufwendig und manches musste ich auch der Übersichtlichkeit halber komprimieren. Deshalb freue ich mich, wenn Sie aus Ihrer Sicht fehlende oder weitere hilfreiche Informationen ergänzen oder verlinken, und auch die Diskussion um die Rezertifizierung (weiter)führen.
Viele Grüße
Elisabeth Wagner
P.S.
18.10.2023
Habe eben gesehen, dass ich mir selbst 5 Sterne verpasst habe. Sorry, das war ein Versehen. Normalerweise überlasse ich das Bewerten der eigenen Beiträge den Leserinnen und Lesern.
Elisabeth Wagner
PRINCE2 mit neuer Version
18.10.2023
Eine Ergänzung zum fachlich gut fundierten Artikel, der aus dem Jahr 2019 stammt: Mittlerweile gibt es eine gravierende Überarbeitung von PRINCE2. Es ist die Version 7. Es wäre klasse wenn Sie das Update in den Fachartikel einbinden könnten. Als PRINCE2-Trainer kann ich Ihnen gerne alle Informationen dazu geben. Eine Zusammenfassung findet sich auf unserer Website: https://copargo.de/prince2-7-das-vollstaendigste-framework/
PRINCE2 7 wurde berücksichtigt und wird bald separat behandelt
18.10.2023
Hallo Herr Buhr,
danke für Ihre Anmerkung. Sie haben Recht, dass wir diesen Artikel ursprünglich 2019 veröffentlicht haben, die heute veröffentlichte neue Version wurde jedoch vollständig überarbeitet und aktualisiert. Sie enthält einen Hinweis auf die neue Version des PRINCE2 Handbuchs (am Ende des Teils zu PRINCE2).
Danke auch für Ihr Angebot! Wir haben bereits einen Beitrag zu PRINCE2 7th Edition in Arbeit, der auf die Aktualisierungen eingeht und in einer der nächsten Ausgaben erscheinen wird.
Vielen Dank und freundliche Grüße aus der Redaktion
Daniel Vienken
projektmagazin 1 Monat kostenlos testen!
Das projektmagazin - unverzichtbares Nachschlagewerk und Inspirationsquelle für alle, die in Projekten arbeiten.