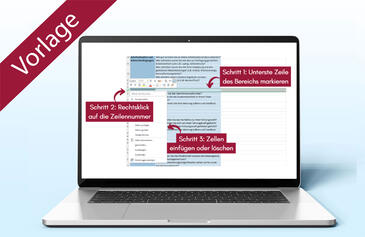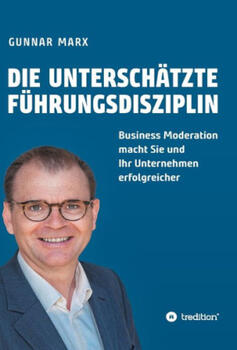Kommunikationskonflikte meistern Erkennen und lösen Sie Konflikte mit dem Eisbergmodell

Bei der zwischenmenschlichen Kommunikation kommt es oft auf das "Wie" an. Viele Missverständnisse lassen sich durch das Eisbergmodell erklären. Dieser Artikel beschreibt, wie Sie damit Konflikte vermeiden und lösen.
Management Summary
Als Mitglied erhalten Sie die wichtigsten Thesen des Beitrags zusammengefasst im Management Summary!
Kommunikationskonflikte meistern Erkennen und lösen Sie Konflikte mit dem Eisbergmodell

Bei der zwischenmenschlichen Kommunikation kommt es oft auf das "Wie" an. Viele Missverständnisse lassen sich durch das Eisbergmodell erklären. Dieser Artikel beschreibt, wie Sie damit Konflikte vermeiden und lösen.
Management Summary
Als Mitglied erhalten Sie die wichtigsten Thesen des Beitrags zusammengefasst im Management Summary!
Am 14. April 1912 bekam der Kapitän der Titanic eine bekannte Tatsache zu spüren: nämlich, dass über dem Wasser nur ein kleiner Teil eines Eisbergs zu sehen ist und sich der größte Teil unter Wasser befindet. Das Wissen um die Gefahren, die von einem Eisberg ausgehen, können für die Seefahrt überlebenswichtig sein.
Um Leben und Tod geht es bei der Kommunikation zwischen Menschen zwar in der Regel nicht. Aber darum, dass unsere Kommunikation nur zu einem kleinen Teil im Sichtbaren stattfindet und das Gros des zwischenmenschlichen Austauschs unter der Oberfläche – im Unterbewussten – erfolgt.
Mithilfe des Eisbergmodells lassen sich viele Missverständnisse und Konflikte erklären. Aber nicht nur das: Dieses Modell ist auch ein Hebel, um Fehlurteile aufzulösen und zu einer konstruktiven Kommunikation zu finden. Dieser Artikel beschreibt an typischen Beispielen aus der Projektpraxis, wie Sie es erfolgreich anwenden können.
Das Eisbergmodell
"Ich bin mir sicher, Sie werden einen guten Vortrag halten." Diese Aussage von Klaus Müller, dem Projektleiter von Kim Mayer, kann zwei unterschiedliche Bedeutungen haben: Wird sie von einem freundlichen Lächeln und einem Schulterklopfen begleitet, dann ist sie als Unterstützung gedacht. Sagt Müller den Satz mit leiser Stimme und ein wenig abfällig, drückt dies aus, dass er skeptisch ist, ob es wirklich ein guter Vortrag wird. Sagt er den Satz in einem neutralen Tonfall und verzichtet weitestgehend auf Gestik und Mimik, hat Kim Mayer einen großen Interpretationsspielraum zwischen den beiden oben genannten Extremen.
Eine Erklärung, warum die gleiche Aussage unterschiedlich interpretiert werden kann, liefert das Eisbergmodell.
Das Eisbergmodell hat mehrere Väter
Die Eisbergmetapher stammt von Ernest Hemingway. Der berühmte Schriftsteller war der Auffassung, dass es reiche, wenn er in seinen Werken nur einen Teil des Inhalts darstelle, weil der andere Teil vom Publikum auch so erkannt würde:
Wenn ein Prosaschriftsteller genug davon versteht, worüber er schreibt, so soll er aussparen, was ihm klar ist. […] Ein Eisberg bewegt sich darum so anmutig, da sich nur ein Achtel von ihm über Wasser befindet.
In seiner Persönlichkeitstheorie beschreibt Sigmund Freund ebenfalls einen Sachverhalt, bei dem nur ein Teil der Elemente sichtbar ist. In seinem Modell, das die menschliche Psyche erklärt, hat diese drei Instanzen:
- das Es – das Lustprinzip, das durch Triebe, Wünsche und Bedürfnisse gesteuert wird,
- das Über-Ich – das Moralitätsprinzip, das durch Normen, Werte und die Moral repräsentiert wird,
- das Ich – das Realitätsprinzip, welches das tatsächliche Handeln darstellt.
Nach seiner Theorie liegen die Instanzen Es und Über-Ich größtenteils im unbewussten Teil unserer Psyche. Sie beeinflussen unser Handeln, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Dieser Sachverhalt hat dazu geführt, dass diese Theorie mit dem Eisbergmodell in Verbindung gebracht wird, obwohl Freud selbst diese Metapher nie benutzt hat.
Die Psychologen Floyd L. Ruch und Philip G. Zimbardo verbanden Freuds Persönlichkeitstheorie mit der Eisbergmetapher (Bild 1).

Den Bezug zur zwischenmenschlichen Kommunikation stellte der bekannte Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick her. Mithilfe des Eisbergmodells beschreibt er das Verhältnis von Sach- und Beziehungsebene in der Kommunikation.
Sofort weiterlesen und testen
Erster Monat kostenlos,
dann 24,99 € pro Monat
-
Know-how von über 1.000 Profis
-
Methoden für alle Aufgaben
-
Websessions mit Top-Expert:innen