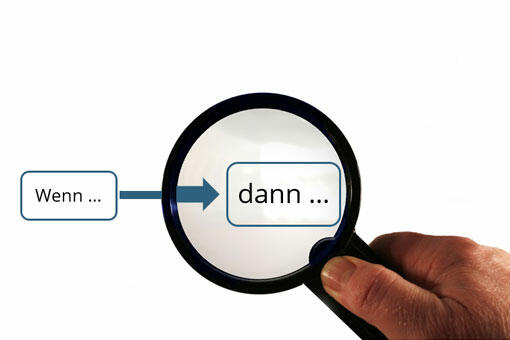
Kategorien Legitimer Vorbehalte (KLV)
Die Kategorien Legitimer Vorbehalte (KLV) liefern ein leicht verständliches Schema, um kausale Zusammenhänge zu überprüfen. Dieses Schema folgt der Grundregel: "Versuche erst zu verstehen, bevor du versuchst, verstanden zu werden". Entwickelt wurden die KLV ursprünglich für die konstruktive Prüfung umfangreicher Logikdiagramme der Theory of Constraints, wie dem Gegenwartsbaum. Aufgrund ihres intuitiv verständlichen Aufbaus lassen sich mit ihnen alle Kausalketten und auch ganz alltägliche Begründungen hinterfragen: z.B. Business Cases von Projekten, Behauptungen von Stakeholdern oder Aussagen von Politikern.
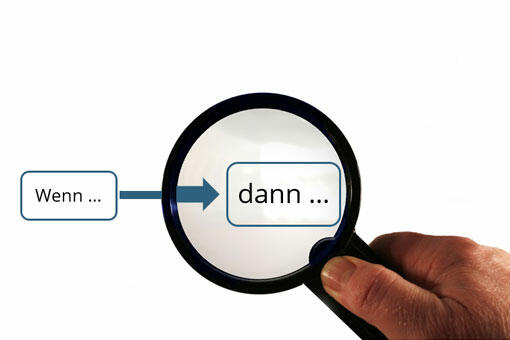
Kategorien Legitimer Vorbehalte (KLV)
Die Kategorien Legitimer Vorbehalte (KLV) liefern ein leicht verständliches Schema, um kausale Zusammenhänge zu überprüfen. Dieses Schema folgt der Grundregel: "Versuche erst zu verstehen, bevor du versuchst, verstanden zu werden". Entwickelt wurden die KLV ursprünglich für die konstruktive Prüfung umfangreicher Logikdiagramme der Theory of Constraints, wie dem Gegenwartsbaum. Aufgrund ihres intuitiv verständlichen Aufbaus lassen sich mit ihnen alle Kausalketten und auch ganz alltägliche Begründungen hinterfragen: z.B. Business Cases von Projekten, Behauptungen von Stakeholdern oder Aussagen von Politikern.
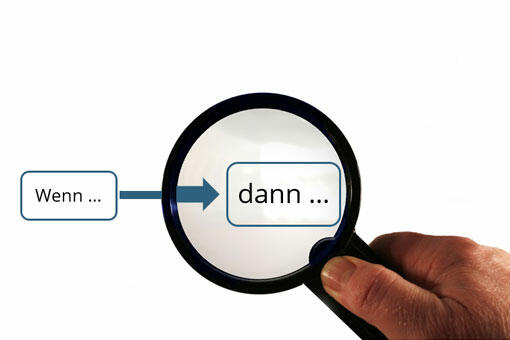
Einsatzmöglichkeiten
- Logische Prüfung von behaupteten Kausalzusammenhängen (z.B. bei der Prüfung eines Projektantrags)
- Logische Prüfung von Kausalitätsdiagrammen (z.B. Ishikawa-Diagramm, positiver/negativer Zweig, Fehlerbaumanalyse, Gegenwartsbaum,Zukunftsbaum, Executive Summary Tree)
- Konstruktives, persönliches Feedback für eine Behauptung oder einen eingebrachten Vorschlag
- Strukturierung der Gruppendiskussion zu einem eingebrachten Vorschlag oder vermuteten Ursache-Wirkungs-Zusammenhang (z.B. im Kernteam-Meeting oder Lenkungsausschuss)
Die KLV können jederzeit ohne Vorbereitung eingesetzt werden. Sowohl einzelne Personen als auch kleine und großen Gruppen können die KLV verwenden. Der Aufwand für ihren Einsatz ist bestimmt von der Komplexität der betrachteten Kausalkette.
Ergebnisse
- Einigkeit der Beteiligten über die Ursachen, Wirkungen und kausalen Zusammenhänge des betrachteten Systems
- Besseres, möglicherweise korrigiertes, gemeinsames Verständnis des Systems und seiner Wirkungszusammenhänge
- Eventuell erweiterte oder korrigierte Kausalitätsbehauptung/li>
Vorteile
Durchführung: Schritt für Schritt
Die Kategorien Legitimer Vorbehalte beruhen auf der Grundregel: "Versuche erst zu verstehen, bevor du versuchst, verstanden zu werden". Dies gibt dem Ersteller ein Gefühl der Wertschätzung und vermeidet, dass man aneinander vorbei von zwei verschiedenen Dingen spricht. Daher stammt auch das "legitim" im Methodennamen: Die Vorbehalte gegenüber der präsentierten Logik sollen einen konstruktiven Beitrag leisten, statt nur zu kritisieren.
Die 3 Ebenen der legitimen Vorbehalte: Klarheit, Existenz, Kausalität
Die Kategorien Legitimer Vorbehalte sind in drei Ebenen gruppiert (siehe Bild 1).

Bild 1: Die drei Ebenen der Kategorien Legitimer Vorbehalte
Als Grundregel gilt, dass die Ebenen streng hierarchisch zu durchlaufen sind. D.h. als erstes Ebene I (Klarheit), dann Ebene II (Existenz) und als letztes Ebene III (Kausalität). Innerhalb einer Ebene können die einzelnen Prüfschritte in beliebiger Reihenfolge durchgeführt werden.
In der folgenden Schritt-für-Schritt-Anleitung zeige ich eine auf meiner Erfahrung basierende, detailliertere Reihenfolge – ob für Ihren konkreten Fall die Grundregel ausreicht oder die hier beschriebene Reihenfolge sinnvoll ist, können Sie selbst am besten beurteilen. Ich freue mich über Erfahrungsberichte in den Kommentaren.
Sobald alle Beteiligten einig sind, dass die Ursache-Wirkungs-Darstellung so richtig ist, sind Sie fertig! Sie müssen also nicht immer alle Schritte durcharbeiten.
Tipp: Wenn Sie ein komplexeres Logikdiagramm mit mehreren kausalen Verbindungen prüfen, führen Sie die einzelnen Schritte jeweils für alle Elemente des Diagramms durch, bevor Sie zum nächsten Schritt übergehen. So vermeiden Sie unnötige Doppelarbeit aufgrund der Beziehungen zwischen den Elementen.
Sofort weiterlesen und testen
Erster Monat kostenlos,
dann 24,99 € pro Monat
-
Know-how von über 1.000 Profis
-
Methoden für alle Aufgaben
-
Websessions mit Top-Expert:innen










