
Leseprobe Projektplanung - so geht's!

Ein Projekt steht und fällt mit der richtigen Planung. Im letzten Teil der Einführungsserie in das Projektmanagement erfahren Sie, wie Sie ein Projekt zielgerichtet planen und welche Techniken und Hilfsmitteln Ihnen dafür zur Verfügung stehen. Die 21 Schritte des Projekterfolgs fassen übersichtlich die einzelnen Schritte innerhalb eines Projektablaufs zusammen.
Inhalt
- Top-Down-Methode
- Bottom-Up-Methode
- Projektstrukturplan (Gliederung)
- Balkendiagramm (Gantt-Diagramm)
- Grundlagen der Netzplantechnik
- Critical Path Method (CPM)
- Programm Evaluation Review Technique (PERT)
- Einsatzmittel- und Kostenplanung
- Meilensteine
- Chronologisches Vorgehen
- 21 Schritte zum Projekterfolg
Leseprobe Projektplanung - so geht's!

Ein Projekt steht und fällt mit der richtigen Planung. Im letzten Teil der Einführungsserie in das Projektmanagement erfahren Sie, wie Sie ein Projekt zielgerichtet planen und welche Techniken und Hilfsmitteln Ihnen dafür zur Verfügung stehen. Die 21 Schritte des Projekterfolgs fassen übersichtlich die einzelnen Schritte innerhalb eines Projektablaufs zusammen.
Inhalt
- Top-Down-Methode
- Bottom-Up-Methode
- Projektstrukturplan (Gliederung)
- Balkendiagramm (Gantt-Diagramm)
- Grundlagen der Netzplantechnik
- Critical Path Method (CPM)
- Programm Evaluation Review Technique (PERT)
- Einsatzmittel- und Kostenplanung
- Meilensteine
- Chronologisches Vorgehen
- 21 Schritte zum Projekterfolg
Unter Projektplanung versteht man die systematische Informationsgewinnung über den künftigen Ablauf des Projekts und die gedankliche Vorwegnahme des notwendigen Handelns im Projekt. Grundsätzlich steht und fällt erfolgreiche Projektarbeit mit der sorgfältigen, zielgerichteten Planung. Es gibt das geflügelte Wort: "Wenn Sie beim Planen versagen, planen Sie Ihr Versagen". Der Projektplan legt die Sollvorgaben fest, anhand derer später die Projektüberwachung und -steuerung den Soll/Ist-Vergleich macht, Abweichungen erkennt und Korrekturmaßnahmen einleitet.
Planen bedeutet unter anderem, auf Erfahrungen zurückzugreifen. Gerade das aber ist bei neuen Projekten nur bedingt möglich. Die Gefahr, Fehler zu machen, ist groß. Eine besonders gründliche Vorgehensweise wird daher nötig. Es empfiehlt sich, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Definieren Sie das Projektziel genau (Hauptziele und Nebenziele)
- Erstellen Sie Unterlagen, in denen das Projekt genau analysiert wird (logische Abläufe)
- Planen Sie dynamisch (Unterlagen iterativ auf den neuesten Stand bringen, Erkenntnisse, Änderungen, Auswirkungen mit einbeziehen)
Bei der Gliederung von Projekten existieren zwei Gliederungsmöglichkeiten: Die Top-Down-Methode und die Bottom-Up-Methode. Je nach Projektart und bereits begonnener Planung sollte sich der Verantwortliche für eine der beiden Techniken entscheiden.
Top-Down-Methode
Bei dieser Methode beginnt der Projektplaner mit der Grobplanung (Top = Oben). Anschließend wird jeder Teilpunkt der Grobplanung weiter unterteilt, bis am Ende die einzelnen Vorgänge (Down = nach unten) stehen. Hier schafft der Planer zuerst das Gliederungsgerüst, das er anschließend mit Vorgängen füllt.
Bottom-Up-Methode
Diese Methode funktioniert genau umgekehrt, also von unten nach oben. Sie ist sinnvoll, wenn bereits alle oder fast alle Einzelvorgänge als ungeordnete Liste bekannt und vorhanden sind. Hier muss der Verantwortliche dann nur noch eine Gliederungsstruktur für den Ablauf der Vorgänge suchen. Das Gliederungsgerüst entsteht aus den einzelnen vorhandenen Vorgängen. Häufig sind weitere Zusatzgliederungen notwendig, etwa nach Abteilungen, Kostenstellen oder Produktarten.
Planungsarten
Folgende Einzelpläne sind notwendig und müssen in einem Projektplan dokumentiert werden:
- Strukturplan: Wie ist das Projekt strukturiert?
- Ablaufplan: Wie soll das Projekt ablaufen?
- Terminplan: Welche Termine gelten für das Projekt?
- Kapazitätsplan: Welche Ressourcen sind erforderlich?
- Kostenplan: Welche Kosten erfordert das Projekt?
Im folgenden Kapitel erfahren Sie die gebräuchlichsten Methoden der Projektplanung.
Projektstrukturplan (Gliederung)
Eine sinnvolle Projektstrukturierung, also die Gliederung eines Projekts in Teilprojekte, Sammelvorgänge und Einzelvorgänge, ist Voraussetzung für eine transparente Projektplanung und Projektüberwachung. Das wirkungsvollste Instrument dafür ist der Projektstrukturplan (PSP). Im Englischen heißt dieses Verfahren Work Breakdown Structure (WBS).
Es gibt objektorientierte und funktionsorientierte Projektstrukturpläne. Mit einem funktionsorientierten PSP ist die Planung anhand von Vorgängen gemeint, mit "objektorientiert" die Planung anhand von Lösungen. Beim Bau eines Hauses würde der Planer die Phase "Fundament graben" im objektorientierten PSP als "Fundament" bezeichnen, im funktionsorientierten PSP als "Fundamentieren".
Balkendiagramm (Gantt-Diagramm)
Das Gantt-Diagramm, benannt nach dem von Lawrence Gantt um 1900 erfundenen System zur Kontrolle der Arbeitsleistung, stellt den Termin- und Ablaufplan eines Projekts als Balkendiagramm dar. Der Projektplaner kann die Dauer jeder Tätigkeit als horizontale Linie oder Balken deutlich machen. In der ursprünglichen Form der Gantt-Diagramme, die als Vorläufer der Netzplantechnik gelten, werden strukturelle Zusammenhänge zwischen den einzelnen Vorgängen nicht sichtbar.
Sinn ist die Darstellung einer für Steuerung und Kontrolle notwendigen präzisen Ablauflogik. Die modernste Form dieser "klassischen" Darstellungsmethode ist der vernetzte Balkenplan, der auch die Abhängigkeitsstruktur der einzelnen Tätigkeiten in das Gantt-Diagramm einbezieht. Wegen mangelnder Übersichtlichkeit bei der Verknüpfung ist der Balkenplan nur bei Projekten mit wenigen Vorgängen sinnvoll.

Grundlagen der Netzplantechnik
Die Netzplantechnik hat ihren Ursprung in den fünfziger Jahren. Beispiele hierfür sind auftragsgebundene, terminorientierte Einzelfertigungen wie der Bau von Schiffen, Verkehrswegen, Gebäuden, Industrieanlagen und anderes mehr. Diese in den Ingenieurbereichen erfolgreich angewendeten Netzplantechniken fanden schnell Eingang in die Wirtschaft zum Beispiel bei der Einführung neuer Produkte, bei der Umstellung von Firmen auf andere Produktionsmethoden oder bei der Einführung der elektronischen Datenverarbeitung.
Der Netzplan ist eine graphische oder tabellarische Darstellung von Abläufen und deren Abhängigkeiten. Er ist aufgebaut aus mehreren Elementen, den Ereignissen beziehungsweise Vorgängen. Sie beinhalten je nach Netzplanart verschiedene Informationen zur Berechnung ihrer Anfangs- und Endzeitpunkte und damit zur Berechnung des Projektendtermins. Durch Anordnungsbeziehungen miteinander verbunden und durch Zeitabstände voneinander getrennt, ergeben die Elemente einen logischen Zusammenhang: den Ablaufplan.
Zwei in Microsoft Project kombinierte Methoden werden hier in Grundzügen vorgestellt:
- Critical Path Method (CPM)
- Program Evaluation Review Technique (PERT)
Critical Path Method (CPM)
CPM ist ein mathematisches Modell, das die Gesamtdauer eines Projekts auf Grundlage der Dauer und Abhängigkeiten der einzelnen Vorgänge berechnet. Es gibt an, welche Vorgänge kritisch sind. Die Abfolge der kritischen Vorgänge eines Projekts bildet den kritischen Weg. Eine Verzögerung der kritischen Vorgänge verzögert automatisch auch das Projekt. Das CPM-Modell ist heute das fundamentale Verfahren in der PM-Software und wird in Microsoft Project in Kombination mit der PERT-Darstellung verwendet.
Programm Evaluation Review Technique (PERT)
In diesem Modell sind die Vorgänge (hier Ereignisse genannt) als Knoten dargestellt. Die Projektdauer wird aufgrund statistischer Wahrscheinlichkeiten anhand der eingegebenen Zeitdauer der Vorgänge berechnet. Mit dieser Methode lassen sich auch Wahrscheinlichkeiten für das Eintreffen von Terminen ausrechnen (Risikoanalyse). Die CPM-Methode ist insofern integriert, als der kritische Weg hervorgehoben und in einer anderen Farbe gekennzeichnet wird.
Einsatzmittel- und Kostenplanung
Die Verfahren CPM und PERT, die zunächst nur das Zeitkriterium berücksichtigen, wurden verfeinert und ausgebaut, in dem man Kostengesichtspunkte und Ressourcenmanagement einbezog. Da in der Regel sowohl das Budget als auch die Ressourcen für ein Projekt begrenzt sind, kommt der Kosten- und Ressourcenplanung eine große Bedeutung zu. Anhand des Projektstrukturplans kann der Verantwortliche für jede Projektphase einen detaillierten Kosten- und Einsatzmittelplan erstellen. Den für jeden Vorgang erfassten Bedarf an Ressourcen kann er der tatsächlichen Kapazität gegenüberstellen (Kapazitätsanalyse). Ziel ist eine minimale Projektdauer.
Ressourcenänderungen beeinflussen meist die Zeitplanung. PM-Software bietet diverse Möglichkeiten der Ressourcenoptimierung und des Ressourcenausgleichs. So kann der Projektverantwortliche Ressourcen automatisch oder auch manuell ausgleichen und verlagern. Für die Ressourcenzuordnung gibt es verschiedene Auslastungsmodelle.
Die Kosten- und Gewinnplanung fügt die Erfolgskontrolle in das System ein. Sie ermittelt - angelehnt an den PSP - aus den Kosten für die einzelnen Aktivitäten die Kosten für das Gesamtprojekt sowie den optimalen zeitlichen Kosten- und Budgetverlauf. Ziel ist die Maximierung des Projektgewinns oder die Minimierung der Projektkosten, je nach Projekt. Detaillierte Kostenpläne und -kontrollverfahren beziehen neben Fixkosten und variablen Kosten für Einsatzmittel und Personal auch Gemeinkosten, also feste Kosten, mit ein, die dem Projekt als Gesamtheit und nicht einzelnen Vorgängen zuzuordnen sind. Darunter fallen zum Beispiel Kosten für angemietete Büroräume.
Meilensteine
Der Projektleiter definiert Meilensteine. Das sind Ereignisse, die die Grundlage für Entscheidungen bilden. Im Projektplan werden Meilensteine als Freigabetermine an das Ende der entsprechenden Projektphase gesetzt.
Chronologisches Vorgehen
Hier eine Zusammenfassung der chronologischen Vorgehensweise bei der Projektplanung:
- Projekt gliedern in Funktionen und Objekte
- Arbeitspakete erstellen
- PSP erstellen
- Projektvorgänge ermitteln
- Netzplan erstellenTerminplanung erstellen
- Ressourcen und Kosten zuordnen
- Kapazitäten abgleichen
- Meilensteine als Kontrollzeitpunkte setzen
- Balkenpläne als Entscheidungsgrundlage erstellen
21 Schritte zum Projekterfolg
Nachfolgend werden die für Gliederung, Planung und Durchführung wichtigen Sachinhalte in 21 Schritten zusammengefasst dargestellt:
| Projektschritt | Methode |
|---|---|
| Projektauftrag | |
| 1. Projektgegenstand wird bestimmt. Hintergründe und Ausgangssituation werden abgeklärt | Projektdefinition |
| 2. Definition der Projektziele | Projektauftrag |
| 3. Abklären der organisatorischen Rahmenbedingungen | Projektorganisation |
| Grobplanung | |
| 4. Zerlegung des Gesamtprojektes in Arbeitspakete und Beschreibung von Aufgabeninhalt und Umfang | Projektstrukturplan |
| 5. Festlegung, wer wie an welchen Arbeitspaketen beteiligt ist. | Ressourcenplan |
| 6. Schätzung und Abstimmung der Kapazität und der Kosten | Kosten- und Kapazitätsplan |
| 7. Definition und Terminierung von Projekt-Zwischenergebnissen | Meilensteinplan |
| 8. Beurteilung und Bewertung der Risiken, Revision der Planung |
Risiken und Konsequenzen |
| 9. Organisieren und Einrichten der Projektinformation und -dokumentation | Informationswesen |
| Feinplanung | |
| 10. Zerlegung der Arbeitspakete in Aktivitäten und Verteilung an die Beteiligten | Aktivitätenliste |
| 11. Ermittlung der erforderlichen Kapazität und der Dauer der Aktivitäten | Kapazitätenplan |
| 12. Analyse der Abhängigkeiten | Ablaufstruktur |
| 13. Ermittlung der Anfangs-/Endtermine der Aktivitäten | Balken/Netzplan |
| 14. Ermittlung wesentlicher/kritischer Aktivitäten und Definition der Arbeitsziele | Interner Meilensteinplan |
| 15. Kalkulation/Festlegung erforderlicher Kosten je Aktivität | Kostenplan |
| Steuerung/Überwachung | |
| 16. Planung der Kontrollmethodik (Kontrollparameter, Kontrollform) |
Rückmeldewesen |
| 17. Information über ungeplante Ereignisse | Änderungsmitteilung |
| 18. Sammlung und Darstellung der vereinbarten Informationen | Statusbericht/Meeting |
| 19. Soll-Ist-Vergleich | Abweichungs-/Trendanalysen |
| 20. Einleitung und Überprüfung von Steuerungsmaßnahmen | Statusbericht/Meeting |
| 21. Meilensteinpräsentation/ Projektergebnispräsentation |
Abnahme/Freigabe |









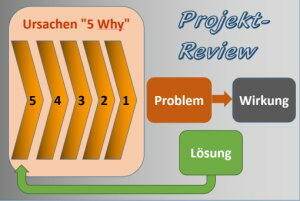
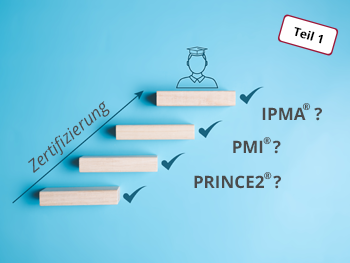




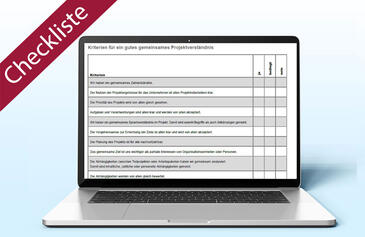



Stephan Johannsen
16.08.2018