
Paradigmenwechsel in der Zusammenarbeit Kollaboration – was Führung dazu wissen muss

Ad hoc, bereichsübergreifend und quer zur Hierarchie: Als flexible und schnelle Form der Zusammenarbeit erlaubt Kollaboration, komplexe Fragestellungen mit hoher Geschwindigkeit zu lösen. Warum sich Führungskräfte und Mitarbeiter in der heutigen VUCA-Welt mit neuen Formen der Zusammenarbeit beschäftigen müssen und welchen Nutzen sie davon haben, zeigt Dr. Susanne Ehmer anhand von Praxisbeispielen, Tipps sowie Übungen für den eigenen Weg zur Kollaboration.
Management Summary
Als Mitglied erhalten Sie die wichtigsten Thesen des Beitrags zusammengefasst im Management Summary!
Inhalt
Paradigmenwechsel in der Zusammenarbeit Kollaboration – was Führung dazu wissen muss

Ad hoc, bereichsübergreifend und quer zur Hierarchie: Als flexible und schnelle Form der Zusammenarbeit erlaubt Kollaboration, komplexe Fragestellungen mit hoher Geschwindigkeit zu lösen. Warum sich Führungskräfte und Mitarbeiter in der heutigen VUCA-Welt mit neuen Formen der Zusammenarbeit beschäftigen müssen und welchen Nutzen sie davon haben, zeigt Dr. Susanne Ehmer anhand von Praxisbeispielen, Tipps sowie Übungen für den eigenen Weg zur Kollaboration.
Management Summary
Als Mitglied erhalten Sie die wichtigsten Thesen des Beitrags zusammengefasst im Management Summary!
Inhalt
Märkte und Bedürfnisse verändern sich, Technologien sind leichter zugänglich und nutzbar, mindestens drei sehr unterschiedliche Generationen gestalten aktiv Gesellschaft und Organisationen. Auf all das müssen Organisationen eingehen, um die Kunden-Wünsche frühzeitig erkennen und schnell und treffsicher beantworten zu können. Allein mit dieser kurzen Aufzählung werfen wir bereits einen Blick mitten hinein in die Welt von VUCA – von Volatilität, Ungewissheit, C(K)omplexität und Ambiguität (siehe auch Ehmer et al.; 2016).
Zusammenarbeit in Form von Kollaboration (siehe Kasten) ist eine Antwort auf diese Herausforderungen. Natürlich wird in Unternehmen schon immer zusammengearbeitet – jedoch meist nur im eigenen Bereich und mit seriell verknüpften Arbeitsschritten. Schließlich ist es für Organisationen charakteristisch, Aufgaben zu formalisieren, zu regeln, zu reglementieren – und damit allen Akteuren Entlastung und Orientierung zu geben. Denn so weiß jeder, worum er sich kümmern muss und worum nicht.
Wenn man jedoch mit Überraschungen rechnen muss – und in der Welt von VUCA muss man das –, sind starre Regelungen und Definitionen nicht mehr hilfreich. Dann werden neue Denkmodelle benötigt, die Zusammenarbeit jenseits der klassischen Hierarchie und dem abgrenzenden Bereichsdenken ermöglichen. Diese Modelle helfen dabei, das komplexe soziale System der Organisation zu lenken und zielgerichtet zu beeinflussen, um weiterhin Mehrwert stiften zu können.
Dieser Artikel zeigt, weshalb sich Führungskräfte und Mitarbeitende mit neuen Formen der Zusammenarbeit beschäftigen müssen, worin der Nutzen liegt und wie Kollaboration ganz praktisch funktionieren kann. Dazu liefert der Beitrag Denkanstöße, Praxisbeispiele, Tipps sowie Übungen für den eigenen Weg zur Kollaboration.
Kollaboration
"Kollaboration" (lat.: collaborare, engl.: collaboration) beschreibt den Aspekt des miteinander Tuns, der aktiven Zusammenarbeit an einem gemeinsamen Projekt bzw. einer gemeinsamen zu lösenden Aufgabe ohne streng definierte Systemgrenzen.
Wann ist Kollaboration notwendig?
- Wenn man die Grenzen der eigenen Expertise erkennt.
- Bei Aufgaben, die nur mit mehreren Disziplinen / Expertisen zu bewältigen sind.
- Wenn es um etwas Neues geht, also bei Aufgaben und Themen, die (noch) nicht mit dem vorhandenen Wissen bzw. den bestehenden Strukturen oder Handlungen gelöst wurden.
Kollaboration – interdisziplinär, interhierarchisch und zugleich pragmatisch
Als eher fraktale, d.h. mehrdimensionale Form der Zusammenarbeit mit offenen bzw. vorab nicht streng definierten Systemgrenzen, unterscheidet sich Kollaboration deutlich von Kooperation (bzw. Projektarchitektur oder Matrixstruktur). Bei letzterer wird die vereinbarte Gesamtaufgabe in unterschiedliche Teilaufgaben gegliedert, für die jeweils verschiedene Personen oder Teams verantwortlich sind. Bedingt durch die Arbeitsteilung, verfolgen diese jeweils verschiedene Teilziele. Die Kooperationspartner müssen dabei weder am selben Ort sitzen, noch müssen sie sich kennen.
Kollaboration ist dagegen eine synchrone Arbeit an einem Thema. Auf diese Weise lassen sich komplexe Fragestellungen, die kein "Nacheinander" und kein "Nebeneinander" erlauben, mit hoher Geschwindigkeit lösen – auch bei Unterschieden und Widersprüchen. Diese Intensität kann Kooperation i.d.R. nicht bieten. Kollaboration konstituiert sich ad hoc, interessensgeleitet, vorübergehend, selbstorganisiert, selbstverantwortlich, quer zur Hierarchie oder zu Prozessen – in jedem Fall jedoch bezogen auf die gemeinsame Wertschöpfung. Diese mehrdimensionale Form (interdisziplinär, hierarchie- und bereichsübergreifend, bedarfsbezogen, in jeweils passender Zusammensetzung und Arbeitsform) ermöglicht ein hohes Maß an inhaltlicher, zeitlicher und personeller Flexibilität. Keine langwierige Projektplanung mit zeitaufwendigen Genehmigungsverfahren, sondern ein beinahe sofortiges Starten der inhaltlichen Arbeit!
Beispiel: Zusammenführung zweier Teilbereiche in der Produktion
Im Beispielunternehmen war die Produktion traditionell entlang der Materialschmelze, des Formgusses, der Abkühlung und Kontrolle bis hin zur Verpackung strikt getrennt in die Bereiche "Heiß" und "Kalt". Man wusste um die Existenz des jeweils anderen Bereichs, hatte jedoch wenig Einblick, was genau dort passierte, was die spezifischen Anforderungen waren und welche Punkte heikel waren – wo also jeweils die Knackpunkte lagen. Selbst die Fachbegriffe waren nicht durchgehend bekannt.
…






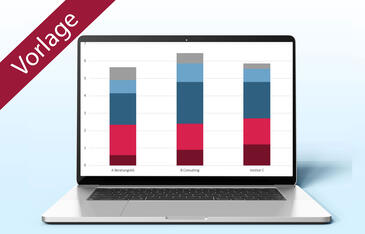



Hartmut Goetze
29.06.2017
s.ehmer
04.07.2017