
Meilensteine – Orientierungspunkte im Projekt
Meilensteine – Orientierungspunkte im Projekt
Meilensteine sind besondere Ereignisse im Projekt, die als Orientierungspunkte im Projektplan dienen. Damit ein Meilenstein seinen Zweck erfüllt, genügt es aber nicht, ihm einen Namen zu geben und einen Zeitpunkt zuzuordnen, wie dies in einem Netzplan üblich ist. Denn wesentliche Aspekte eines Meilensteins sind auch die genaue Spezifikation des Ereignisses bzw. die Benennung der Lieferbedingungen für die zu erbringende Projektleistung, die Angabe seiner Schnittstellen und seine Priorität. Diese werden jedoch bei der Definition des Meilensteins häufig außer Acht gelassen. Versäumt es der Projektleiter, präzise und vollständige Angaben zu machen, werden Meilensteine auf Termine reduziert, deren Erreichen den Leistungserbringern breiten Interpretationsspielraum lässt. Auch ist es dann nur schwer oder ggf. gar nicht möglich zu überprüfen, ob das Ereignis eingetreten bzw. die Leistung erbracht wurde. Für die Steuerung und Überwachung eines Projekts sind solche Meilensteine nahezu nutzlos.
Nimmt der Projektleiter hingegen die Mühe auf sich, die Meilensteine eines Projekts vollständig zu definieren, kann er sich erhebliche Planungsaufwände sparen – bei kleinen und wenig komplexen Projekten mit wenigen Produkten kann eventuell sogar ein Meilensteinplan genügen, um ein Projekt durchzuführen.
Im ersten Teil dieses Beitrags stelle ich systematisch die vollständige Beschreibung von Meilensteinen vor. Dabei orientiere ich mich an den gängigen Standards, an den mir bekannten Best Practices von Projektmanagern und Terminplanern sowie an meiner eigenen Projekterfahrung. In welcher Form die Beschreibung eines Meilensteins dokumentiert wird, ist für das Verständnis des Folgenden nicht relevant: Es kann sich um eine Meilenstein-Tabelle handeln, bei der die Informationen zu einem Meilenstein verteilt auf verschiedene Spalten nebeneinander stehen oder um ein eigenes Dokument für jeden einzelnen Meilenstein. Wichtig ist, dass die hier aufgeführten Informationen gebündelt und für alle Betroffenen zugänglich in einer Meilenstein-Dokumentation abgelegt werden.
Bei meiner Darstellung erhebe ich weder Anspruch auf Vollständigkeit noch darauf, dass es sich dabei um die einzig mögliche Sichtweise handelt. Vielmehr möchte ich Projektverantwortliche darauf aufmerksam machen, welche Aspekte bei der Festlegung von Meilensteinen wichtig sind, die diese vielleicht bisher nicht wahrgenommen haben. Vor allem aber möchte ich Sie dazu anregen, sich mit der Thematik "Meilensteine in Projekten" kritisch auseinander zu setzen. Termin + Ereignis = Meilenstein?
Definition des Begriffs "Meilenstein"
Auf den ersten Blick erscheint der Begriff "Meilenstein" wohldefiniert zu sein. Die DIN 69900:2009 bezeichnet ihn als "Ereignis besonderer Bedeutung". Der PMBOK® Guide, 4th Edition, beschreibt den "milestone" ganz ähnlich als "significant point or event in the project". Am ausführlichsten definiert PRINCE2:2009 den Meilenstein: "Ein bedeutendes Ereignis im Zeitverlauf eines Plans, beispielsweise die Fertigstellung wichtiger Arbeitspakete, der Abschluss einer technischen Phase oder einer Managementphase."
Bei genauerer Betrachtung fällt aber auf, dass keine der genannten Richtlinien den Meilensteinen eine besondere Bedeutung beizumessen scheint. Einzig die DIN 69901-2:2009 führt in ihrem Prozessmodell den Prozess "Meilensteine definieren" auf. Ansonsten spielen Meilensteine in den Richtlinien weder als Planungs- noch als Steuerungselement eine Rolle.
Dies ist umso überraschender, da nach meiner Beobachtung "Meilenstein" der wohl bekannteste Fachbegriff des Projektmanagements in der Umgangssprache ist und auch von Laien intuitiv verstanden wird, während z.B. das Konzept des Projektstrukturplans nur Fachleuten geläufig ist. Dementsprechend wäre es zu erwarten, dass die Standards und Lehrbücher des Projektmanagements sich detaillierter mit dem Element "Meilenstein" auseinandersetzen. Ich kann nur darüber mutmaßen, warum sie dies nicht tun: Vielleicht erscheint dies den verantwortlichen Institutionen und Autoren zu trivial. Dies ist aber keineswegs der Fall, wie die folgenden Überlegungen zeigen sollen.
Als Bestandteile eines Meilensteins werden meist nur zwei Dinge genannt:
- der Termin, der den Meilenstein zeitlich festlegt
- die Beschreibung des Ereignisses, das den Meilenstein charakterisiert
Beide Punkte verdienen eine genauere Betrachtung, bevor wir weitere Eigenschaften eines Meilensteins analysieren.
Der Termin
Auf die Frage "Wie lange dauert ein Meilenstein?" reagieren die meisten Experten mit einem Kopfschütteln und erklären herablassend, dass man bei einem Meilenstein nicht von einer Dauer, sondern nur von einem Zeitpunkt sprechen könne.







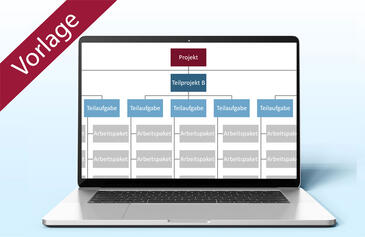



J. Tiekötter
29.06.2011
Thomas Wirtl
16.09.2017
Dr. Georg Angermeier
16.09.2017