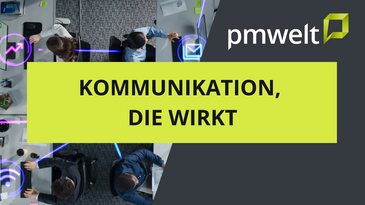Moderationsmethode
Die Moderationsmethode ist ein etabliertes Instrument für die Problemlösung in einer Gruppe. Diese strukturierte Vorgehensweise wird im Rahmen eines Workshops eingesetzt und ermöglicht es der moderierenden Person, die Gruppe schrittweise zum Ergebnis zu führen.
Moderationsmethode
Die Moderationsmethode ist ein etabliertes Instrument für die Problemlösung in einer Gruppe. Diese strukturierte Vorgehensweise wird im Rahmen eines Workshops eingesetzt und ermöglicht es der moderierenden Person, die Gruppe schrittweise zum Ergebnis zu führen.
Die Moderationsmethode wurde Ende der 1960er-Jahre vom "Quickborner-Team" entwickelt und 1980 in einer Loseblattsammlung erstmals veröffentlicht. Das kleine Beraterteam fragte sich damals: Wie können wir Betroffene an Problemlösung- und Entscheidungsprozessen aktiv beteiligen? Als Antwort auf diese Frage entwickelten sie ein Vorgehen, das unter dem Namen "Moderationsmethode" bzw. "Metaplan-Methode" bekannt geworden ist.
Heute ist sie ein fester Bestandteil der Gruppenarbeit und prägt mit den dafür entwickelten Arbeitsinstrumenten die Besprechungsräume. Ihre Elemente werden in angepasster Form auch in agilen Meetings und in Online-Besprechungen eingesetzt.
Mittlerweile bereichern ähnliche Vorgehensweisen und Techniken, die aus anderen Ansätzen wie Facilitation (siehe auch "Facilitation: eine Geheimwaffe im Projektmanagement?") oder Prozessbegleitung stammen, die klassische Moderationsmethode. Auch aus der agilen Welt kommen Prinzipien und Techniken, die sich gut mit den hier vorgestellten verbinden lassen, wie Kanban, Retrospektiven oder Timeboxing.
Welche Schritte umfasst der Prozess?
Mit der Moderationsmethode wird ein Problemlösungsprozess in einem Team gestaltet. Bestandteil der Methode sind auch die Techniken, die in den einzelnen Prozessschritten eingesetzt werden, sowie Arbeitsmaterialien für die Durchführung der Techniken. Die Teilnehmenden durchlaufen dabei im Rahmen eines Workshops sechs voneinander unterscheidbare Phasen (Bild1).
Prozessschritt 1: Teilnehmende einstimmen
Wie bei einem Konzert die Instrumente aufeinander eingestimmt werden, ist es die erste Aufgabe der Moderation, die Teilnehmenden aufeinander einzustimmen, indem sie eine Vorstellungsrunde durch-führt und/oder die Teilnehmenden bittet sich zu äußern, inwieweit sie vom Problem betroffen sind. Damit bekommen sie ein gemeinsames Verständnis vom Ablauf des Workshops und erfahren, welche Ziele mit dem Workshop erreicht werden sollen. Diese Runde wird auch Check-in genannt (siehe dazu im Beitrag "Mit dem Retroboard effektive Retrospektiven abhalten" das Kapitel "Die Retrospektive Schritt für Schritt erklärt").
Prozessschritt 2: Orientierung ermöglichen
Im zweiten Prozessschritt benennt die Moderation das Problem und grenzt es ab gegenüber anderen Problemen und Fragen. Erst wenn alle ein gemeinsames Verständnis des Problems haben, kann die Gruppe eine gemeinsame Lösung erarbeiten.
Prozessschritt 3: Themen bearbeiten
Zur Erarbeitung einer Lösung zerlegt das Team das Problem in mehrere Teilthemen, die kleine Gruppen für sich bearbeiten.
Prozessschritt 4: Lösungen entwickeln
Das gesamte Team kommt wieder zusammen und führt die zuvor erarbeiteten Ergebnisse zusammen zu einer gemeinsamen Lösung.
Prozessschritt 5: Maßnahmen planen
Das Team legt fest, wer die Lösung anschließend wie umsetzt.
Prozessschritt 6: den Workshop abschließen
Im letzten Prozessschritt bewerten die Teilnehmenden das Ergebnis und reflektieren den Lösungsprozess. Der Abschluss bietet auch die Gelegenheit, Punkte und Themen anzusprechen, die im Workshop keinen Platz hatten. Damit findet der Workshop nicht nur einen sachlichen, sondern auch einen emotionalen Abschluss.
Die Arbeitsmaterialien
Die offensichtlichen Merkmale der Methode sind die sogenannten Pinnwände oder Metaplanwände und der Moderationskoffer mit den typischen Arbeitsmaterialien der Methode wie Stifte, Moderationskarten in verschiedenen Formen und Klebestifte. Die damit entstehenden Visualisierungen haben drei Funktionen:
- Sie halten Meinungen und Ergebnisse fest und dienen so als kollektives Gedächtnis.
- Mit ihnen wird der Lösungsprozess gesteuert und sie ermöglichen einen Überblick darüber, wie weit die Gruppe in der Problemlösung gekommen ist.
- Zudem legen die moderierenden Personen damit die Aufmerksamkeit auf die gerade wichtigen Punkte, was fokussiertes Arbeiten fördert.
Bild 2 stellt die traditionellen Materialien für die Moderationsmethode dar. Die Methode kann aber auch mit anderen Materialien durchgeführt werden, z.B. indem man Klebezettel auf Oberflächen von Büromöbeln klebt. Außerdem lässt sie sich auch in Online-Meetings einsetzen. Hier können die Whiteboards der Webtools genutzt werden (siehe dazu "Mit digitalen Whiteboards effizient und kreativ zusammenarbeiten"), aber auch andere Programme für Visualisierungen, wie Power Point (siehe dazu "Bausteine für Projektpräsentationen").

Flip-Chart und Pinnwand sind Medien, auf denen Sie während der Moderation die Arbeitsergebnisse visualisieren können. Das Flip-Chart eignet sich besonders gut zum Mitschreiben von Sachverhalten, zum Notieren der Fragen (z.B. bei der "Blitzlicht-Technik") und für die Arbeit in Kleingruppen. Die Pinnwand ist das Medium für alle Arbeitstechniken, bei denen Karten eingesetzt werden (z.B. bei der "Kartenfrage", dem "Themenspeicher" oder dem "Maßnahmenplan").
Vorbereitung der Moderation
Bevor Sie mit der Moderation starten, sollten Sie sich gut darauf vorbereiten. Für jede Moderation gilt: Je besser die Vorbereitung, desto besser die Moderation selbst. Denn nur mit einer guten Vorbereitung können Sie einen optimalen Lösungsprozess für die Gruppe gestalten. Im Rahmen der Vorbereitung sollten sie versuchen, das Problem zu verstehen und Informationen über die Vorgeschichte und die Teilnehmenden zu recherchieren.
Das Drehbuch für den Workshop
Im Drehbuch wird festgelegt, was, wie und womit der Workshop gestaltet wird. Das Drehbuch (oder Design) der Moderation beschreibt die Struktur, den Inhalt und die Visualisierungen:
- Struktur: Überlegen Sie sich für den Aufbau des Workshops eine klare und für den Kreis der Teilnehmenden nachvollziehbare Struktur auf Basis der sechs Prozessschritte.
- Inhalt: Formulieren Sie die Fragestellung so, dass sie den Kern des Problems trifft. Mit Fragen steuern Sie die Bearbeitung des Themas. Je präziser und passender die Fragen sind, umso leichter fällt es den Teilnehmenden, die Lösung für das Problem zu finden.
- Beispiel: Wenn Probleme in der Zusammenarbeit mit dem Kunden gelöst werden sollen, dann ist die folgende Frage unpräzise: "Wie könnten wir die Zusammenarbeit mit dem Kunden verbessern?" Diese Frage lädt dazu ein, nur mögliche Verbesserungen zu benennen, ohne im Blick zu haben, dass diese auch tatsächlich umgesetzt werden müssen. Präziser ist die Frage: "Was müssen wir tun, damit sich die Zusammenarbeit mit dem Kunden verbessert?"
- Visualisierung: Gestalten Sie Ihre Visualisierungen interessant, z.B. durch Bilder und optische Hervorhebungen. Achten Sie darauf, dass besonders wichtige Punkte durch die Visualisierung betont werden. (siehe dazu "Mit Bildern kommunizieren – Methoden zur Visualisierung")