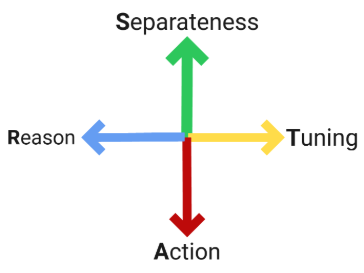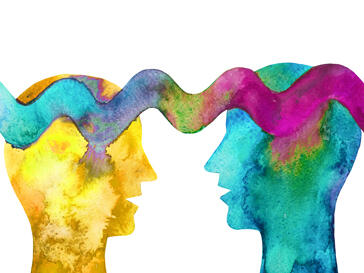Kommunikationsmodelle
Kommunikationsmodelle beschreiben, wie die menschliche Kommunikation funktioniert, welche Faktoren darauf einen Einfluss haben und helfen so, Phänomene in der zwischenmenschlichen Kommunikation zu erklären.
Kommunikationsmodelle
Kommunikationsmodelle beschreiben, wie die menschliche Kommunikation funktioniert, welche Faktoren darauf einen Einfluss haben und helfen so, Phänomene in der zwischenmenschlichen Kommunikation zu erklären.
Was sind Kommunikationsmodelle?
Das Ziel der Kommunikation ist, dem Kommunikationspartner etwas zu übermitteln, was dieser noch nicht kennt. Kommunikationsmodelle sollen die Kommunikation abbilden und beschreiben, wie der Austausch von Informationen funktioniert und welche Faktoren darauf einen Einfluss haben. Sie helfen so, die Phänomene in der menschlichen Kommunikation zu verstehen und zu erklären. Kommunikationsmodelle haben den folgenden Nutzen:
- Sie beschreiben die komplexen Zusammenhänge der Kommunikation
- Sie vereinen die Erkenntnisse unterschiedlicher Fachrichtungen über Kommunikation
- Mit Ihnen werden Kommunikationsstörungen erklärbar
- Mit ihnen können Veränderungen im Kommunikationsverhalten trainiert werden
Die 7 wichtigsten Kommunikationsmodelle
Seit den 1940er Jahren wurde eine Vielzahl an Kommunikationsmodelle entwickelt. Ihre Schöpfer stammen aus sehr unterschiedlichen Wissenschaften, u.a. Kommunikationswissenschaft und Informationswissenschaft, aber auch Mathematik sowie Psychologie. Nachfolgend beschreibe ich die aus meiner Sicht sieben wichtigsten.
1. Das Kommunikationsquadrat
Den Kommunikationsquadrat (auch Vier-Ohren-Modell genannt) wurde vom Hamburger Kommunikationspsychologen deutschen Kommunikationswissenschaftler Schulz von Thun in den 1970-iger Jahren entwickelt. Nach diesem Modell gibt es
:- Sachaspekt: Hier werden Daten und Fakten übermittelt.
- Beziehungsaspekt: Hier werden Informationen über die Beziehung der Kommunikationspartner:innen übermittelt. Der Beziehungsaspekt sagt etwas darüber aus, wie diese zueinander stehen.
- Selbstoffenbarungsaspekt: Hier sagt der Sender bewusst oder auch unbewusst etwas über sich selbst aus.
- Appellaspekt: Dies ist eine direkte oder indirekte Aufforderung an den Empfänger etwas zu tun oder zu lassen.
Das Modell erklärt Störungen in der Kommunikation dadurch, dass der Empfänger die Informationen anders versteht als der Sender sie gemeint hatte. Beispielsweise kann die Aussage einer Projektleitung: "Die Projektabwicklung ist um drei Tage verzögert." vom Teammitglied als Beziehungsaussage so interpretiert werden: "Ihr habt gute Arbeit geleistet." Tatsächlich kann die Projektleitung auf der Beziehungsebene auch genau das Gegenteil meinen, z.B.: "Ich bin von eurer Leistung enttäuscht." (siehe dazu "So gehen Sie mit einem 'Nein' um").
2. Die 5 Axiome zur Kommunikation
Der bedeutende Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick hat fünf Axiome über Kommunikation formuliert, mit denen er erklärt, wie Kommunikation funktioniert.
Axiom 1: "Man kann nicht nicht kommunizieren!"
Kommunikation ist eine Form sozialen Verhaltens. So wie es unmöglich ist, sich gegenüber jemandem nicht zu verhalten, ist es auch unmöglich, nicht zu kommunizieren. Sobald zwei Personen sich gegenseitig wahrnehmen können, kommunizieren sie miteinander.
Axiom 2: "Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt, wobei letzterer den ersteren bestimmt"
Mit jeder Nachricht übermitteln wir eine Botschaft auf zwei Ebenen: eine Sachinformation, die den Inhalt der Kommunikation beschreibt, und einen Hinweis, wie der Sender seine Beziehung zum Empfänger sieht. Der Beziehungsaspekt bestimmt, wie die Nachricht zu interpretieren ist.
Axiom 3: "Die Struktur der Kommunikation wird durch die Interpunktion der Kommunikationspartner bestimmt."
Jede Kommunikation ist im Prinzip eine ununterbrochene Folge von Mitteilungen. Eine Struktur erhält die Kommunikation, indem alle Kommunikationspartner für sich entscheiden, wann ein Kommunikationsablauf beginnt. Praktisch bedeutete dies: Der Sender bestimmt, wann für ihn eine Kommunikationsfolge beginnt. Der Empfänger tut dies unabhängig von der Entscheidung des Senders ebenfalls. Die Kommunikation gelingt nur dann, wenn beide Partner die Kommunikation in gleiche Abschnitte einteilen.
Axiom 4: "Menschliche Kommunikation bedient sich digitaler und analoger Modalitäten."
Watzlawick bezeichnet die verbale Äußerung als "digitale Modalität" und die nonverbale Äußerung als "analoge Modalität". Dieses Axiom besagt also: Kommunikation erfolgt nicht nur durch das gesprochene oder das geschriebene Wort, sondern auch durch nonverbale Äußerungen wie Mimik und Gestik.
Axiom 5: "Zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe sind entweder symmetrisch oder komplementär."
Beide Kommunikationspartner stehen in einer Beziehung zueinander. Eine Beziehung, in der sich die Partner bemühen, Ungleichheiten untereinander möglichst klein zu halten, ist symmetrisch. Eine komplementäre Beziehung ist gekennzeichnet durch Ungleichheit, beispielsweise hierarchische Unterschiede. Damit die Kommunikation gelingt, muss sich das Verhalten der beiden an der Kommunikation beteiligten Personen ergänzen (siehe dazu "Kommunikation in virtuellen Teams").
3. Die Transaktionsanalyse
Die Transaktionsanalyse (TA) konzentriert sich auf das menschliche Verhalten bei der Kommunikation; entwickelt wurde sie von Eric Berne. Die TA unterteilt Fühlen, Denken sowie Verhalten und damit auch das Kommunizieren in drei unterschiedliche Zustände.
- Das Eltern-Ich hat das typische Verhalten von Erziehenden: Es belehrt, ermahnt und korrigiert, umsorgt aber.
- Das Erwachsenen-Ich zeigt ein reflektiertes Verhalten. Es ist wertschätzend, rational und durchdacht. Mit diesem Verhalten lassen sich Probleme und Konflikte gut lösen.
- Das Kindheits-Ich ist gekennzeichnet durch Verspieltheit, Albernheit, Trotz und Spontaneität.
Jeder Mensch kann alle drei Ich-Zustände einnehmen, ganz unabhängig von seinem Alter. Welcher Ich-Zustand gerade aktiv ist, hängt von den Erfahrungen, der aktuellen Kommunikationssituation und den Wünschen und Gefühlen ab.
Konfliktfrei verläuft die Kommunikation dann, wenn die Kommunikationspartner:innen auf der-selben Ebene kommunizieren, z.B. beide aus dem Eltern-Ich. Konflikte entstehen, wenn sich die Kommunikationspartner:innen in unterschiedlichen Ich-Zuständen befinden. Kommuniziert z.B. eine Projektleitung zu sehr aus dem Eltern-Ich heraus, dann kann es passieren, dass sie von den Teammitgliedern nicht ernst genommen wird (siehe dazu "Kommunikation verstehen und be-wusst gestalten mit dem Ich-Zustands-Modell").
4. Das Eisbergmodell
Das Eisbergmodell verdeutlicht die unterschiedlichen Bereiche der Kommunikation. Als Schöpfer werden der Schriftsteller Ernest Hemingway (prägte den Eisberg als Metapher) und der Psychologe Sigmund Freud genannt. 1974 wurde es von Philipp G. Zimbardo / Richard J. Gerrig ausgearbeitet. Das Modell erklärt den Unterschied von Bewusstem und Unbewussten.
Bei einem Eisberg sind nur ca. 20% über der Wasseroberfläche sichtbar, die restlichen ca. 80% befinden sich unter der Wasseroberfläche. Bei der Kommunikation ist ebenfalls nur ein kleiner Teil als bewusste Kommunikation in Form von Sprache und Schrift sichtbar. Der Löwenanteil wird durch Mimik, Gestik sowie Körpersprache übermittelt und wird lediglich unbewusst wahr-genommen. Beide Ebenen stehen in einer Beziehung zueinander. Zu Störungen kommt es dann, wenn die Kommunikation auf den beiden Ebenen inkongruent ist, jemand z.B. etwas anderes sagt, als es gemeint ist (siehe dazu "Erkennen und lösen Sie Konflikte mit dem Eisbergmodell").
5. Gatekeeper-Modelle
Ein Gatekeeper (dt. Torwächter) ist die metaphorische Bezeichnung für einen Faktor, der bei einem Entscheidungsprozess die Auswahl bestimmt. Das Gatekeeper-Modell von Bruce Westley und Malcolm McLean beschreibt die Nachrichtenübermittlung als einen selektiven Prozess, bei dem die übermittelten Informationen durch verschiedene Faktoren ausgewählt werden, bevor sie beim Sender ankommen.
Die Kommunikationskette des österreichischen Verhaltensforschers Konrad Lorenz beschreibt sieben Stufen der Informationsübermittlung mit ihren Hindernissen:
- Gedacht ist nicht gesagt.
- Gesagt" ist nicht gehört.
- Gehört ist nicht verstanden.
- Verstanden ist nicht gewollt.
- Gewollt" ist nicht gekonnt.
- Gekonnt und gewollt" ist nicht getan.
- Getan ist nicht beibehalten.
Das Limbische Kommunikationsmodell geht davon aus, dass unser Gehirn, je nach Menschen-typ, unterschiedliche Präferenzen bei der Aufnahme von Informationen hat. Es unterscheidet:
- Gewinn: Macht die Information mich stärker, besser, erfolgreicher als andere?
- Sicherheit: Macht sie mein Leben sicherer, verlässlicher, vorhersehbarer?
- Verbundenheit: Bringt sie mir soziale Geborgenheit und harmonische Verbundenheit?
- Entdeckung: Hilft sie mir, Neues zu entdecken? Ist sie spannend und abwechslungsreich?
6. Die Lasswell-Formel
Der US-amerikanische Politikwissenschaftler und Kommunikationstheoretiker Harold Dwight Lasswell war 1948 der Erste, der ein Kommunikationsmodell in Form einer Formel präsentierte, die sogenannte Lasswell-Formel: "Wer sagt was in welchem Kanal zu wem mit welcher Wirkung?" (Original: "Who (says) What (to) Whom (in) Which Channel (with) What Effect.").
Die Lasswell-Formel beschreibt das grundlegende Modell der Massenkommunikation, indem sie die vier wichtigsten Elemente in der Kommunikation benennt. Damit leistete er einen wichtigen Beitrag zur Kommunikationswissenschaft und damit auch der Entwicklung der Kommunikationsmodelle.
7. Das Sender-Empfänger-Modell
Ebenfalls Ende der 1940-iger wurde das Sender-Empfänger-Modell entwickelt (von den Mathematikern Claude Shannon und Warren Weaver). Das Modell erklärt, wie Nachrichten übermittelt werden, indem es den aus der Physik bekannten Begriff der Entropie in der Informationstheorie anwendet. Es geht davon aus, dass es bei der Kommunikation zwei unterschiedliche Rollen gibt: Sender und Empfänger.
Jede:r kann beide Rollen einnehmen. Wer eine Nachricht an eine andere Person übermittelt, ist der Sender. Wer eine Nachricht erhält, dann ist der Empfänger. Zwischen beiden gibt es einen Nachrichtenkanal. Damit eine Nachricht darüber übermittelt werden kann, muss der Sender die Nachricht codieren und der Empfänger muss sie wieder decodieren.
Die Kommunikation ist dann erfolgreich, wenn Sender und Empfänger den gleichen Code verwenden. Sie verstehen sich nicht, wenn ihr Code unterschiedlich ist, beispielsweise wenn die beiden verschiedene Sprachen sprechen, sie Begriffe anders interpretieren oder eine unter-schiedliche Mimik und Gestik verwenden (siehe auch "Kommunikation in virtuellen Teams").
Literatur
- Bohinc, Tomas: Kommunikation im Projekt, Gabal Verlag, Offenbach 2014